Berufsbildung: Garantie für soziale Mobilität
Stefan Wolter zeigt im Blogbeitrag auf, weshalb die Berufsbildung einen entscheidenden Beitrag zur sozialen Mobilität leistet.Es mutet wie ein Paradoxon an, wenn behauptet wird, dass die Berufsbildung soziale und ökonomische Mobilität fördern könne, obwohl tertiäre Bildungsabschlüsse nachweislich deutlich höhere Einkommen ermöglichen und gesellschaftlicher Status in weiten Teilen vor allem an akademischen Bildungsabschlüssen und an Bildungsjahren gemessen wird. Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt in drei zentralen Punkten, die zusammengenommen erklären, weshalb die Berufsbildung einen entscheidenden Beitrag zur sozialen Mobilität leistet.
Verhindern von Bildungsabbrüchen
Auch wenn höhere Bildungsabschlüsse über die gesamte Erwerbsbiografie hinweg substanzielle Einkommenszuwächse generieren – in der Schweiz rund vierzig Prozent pro Erwerbsjahr –, zeigt sich in vielen Ländern, dass ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen den Weg zu höherer Bildung nicht erst an der Schwelle zur Tertiärstufe verpasst, sondern bereits beim Versuch scheitert, überhaupt einen nachobligatorischen Abschluss zu erreichen. In diesen Fällen nützen die hohen Einkommensprämien tertiärer Abschlüsse nichts, weil sie für die Betroffenen von Anfang an ausser Reichweite bleiben.
Gerade hier wird die Bedeutung eines starken Berufsbildungssystems sichtbar. Es verhindert in vielen Fällen, dass Jugendliche den Anschluss verlieren, und sichert, dass möglichst viele einen Abschluss auf Sekundarstufe II erlangen. Zwar verfehlt die Schweiz ihr eigenes, ambitiöses Ziel, dass 95 Prozent aller 25-Jährigen einen entsprechenden Abschluss vorweisen können, knapp. Dennoch liegt sie im internationalen Vergleich weiterhin an der Spitze. Dass die Berufsbildung hierbei eine Schlüsselrolle spielt, zeigt sich auch im innerkantonalen Vergleich: Je höher die Beteiligung an der Berufsbildung, desto höher ist auch die Abschlussquote auf der Sekundarstufe II insgesamt.
Berufsbildung als Motivationsfaktor
Es gibt gute Gründe dafür, dass Berufsbildung nicht nur mit Bildungserfolg korreliert, sondern kausal dazu beiträgt. Unabhängig vom jeweiligen Bildungssystem gilt: Am Ende der obligatorischen Schulzeit ist ein grosser Teil der Jugendlichen schulmüde. Systeme, die nur mehr Schule anbieten, verlieren in dieser Phase viele Lernende. Die Möglichkeit, schulisches Lernen mit praktischer Berufserfahrung zu kombinieren und früh in die Erwachsenenwelt einzutreten, wirkt dagegen stabilisierend. Sie motiviert Jugendliche, ihre Ausbildung weiterzuführen.
Hinzu kommt, dass sich in der Berufsbildung für viele die Gelegenheit bietet, Talente einzusetzen und zu entwickeln, die im allgemeinbildenden Unterricht kaum oder gar nicht berücksichtigt werden. Jugendliche, die im traditionellen Bildungskanon mittelmässig geblieben oder gar gescheitert wären, erleben im Lehrberuf nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch einen wichtigen Bildungserfolg. Damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Bildungsbiografie fortsetzen, deutlich erhöht.

Tiefe Maturitätsquote, hohe Tertiärquote
Dieser Mechanismus erklärt, weshalb die Schweiz, obwohl sie im internationalen Vergleich bei der gymnasialen Maturitätsquote zu den Schlusslichtern der OECD zählt, gleichzeitig bei der Tertiärquote überdurchschnittlich abschneidet. Auf den ersten Blick mag das widersprüchlich erscheinen, tatsächlich hängt beides eng zusammen.
In vielen Ländern werden Jugendliche, die zwar die Maturität schaffen konnten, aber nicht über das notwendige Rüstzeug für ein Studium verfügen, durch einen expliziten oder impliziten Numerus clausus vom Studium ferngehalten oder wenden sich nach enttäuschenden Bildungserfahrungen selbst dagegen. Aufgrund fehlender Anschlussmöglichkeiten auf der tertiären Stufe und dem Fehlen eines qualitativ hochstehenden und funktionierenden Berufsbildungssystems, stehen dann viele vor dem Nichts. In der Schweiz hingegen gelangen überdurchschnittlich viele Jugendliche, die andernorts den Bildungsweg abgebrochen hätten, doch noch zu einem höheren Bildungsabschluss. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Berufsbildung ihnen die Motivation und das Erfolgserlebnis vermittelt hat, welche für eine Weiterführung der Bildungskarriere entscheidend sind.
Pluralität, Durchlässigkeit, Qualität und Selektion
Damit Berufsbildung tatsächlich soziale und ökonomische Mobilität ermöglicht, braucht es zusätzliche institutionelle Rahmenbedingungen. Zentral sind vier Elemente: Erstens eine pluralistische Angebotsstruktur auf Tertiärstufe, die nicht nur Universitäten, sondern auch Fachhochschulen und die höhere Berufsbildung umfasst. Zweitens eine ausgeprägte Durchlässigkeit, die es erlaubt, Bildungswege auch nach der obligatorischen Schulzeit zu wechseln. Nur so lassen sich Sackgassen vermeiden, die zur Abwertung der Berufsbildung führen und bewirken würden, dass talentierte Jugendliche sich von Beginn an gegen diesen Weg entscheiden. Drittens eine konsequente Qualitäts- und Arbeitsmarktorientierung, welche sicherstellt, dass die ökonomischen Erträge pro Bildungsjahr vergleichbar hoch sind – unabhängig davon, ob die Ausbildung an einer Universität, einer Fachhochschule oder im Rahmen der höheren Berufsbildung erfolgt.
Und viertens Selektionskriterien im Bildungssystem, die sich direkt an arbeitsmarktrelevanten Anforderungen orientieren. Bildungssysteme mit einem einheitlichen, allgemeinbildenden Modell tendieren dazu, Selektionsentscheidungen an schulischen Fächern festzumachen, die für den Arbeitsmarkt häufig nur eine geringe Bedeutung haben. Die duale Berufsbildung hingegen bindet Unternehmen nicht nur direkt in die Gestaltung der Bildungsinhalte ein, sondern auch die Auswahl und Selektion der Jugendlichen. Dadurch wird sichergestellt, dass die erfolgreich ausgebildeten Lernenden den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen und die Abschlüsse tatsächlich eine ökonomische Mobilität ermöglichen. Vornehmlich allgemeinbildende Systeme führen hingegen häufig zu Mismatches auf dem Arbeitsmarkt, d. h. zu Situationen, in denen Personen im Bildungssystem zwar höchst erfolgreich waren, danach jedoch keine Stelle finden, in der sie ihre erworbenen Kompetenzen einsetzen können.

Unternehmensnachfolge als Sprungbrett
Die ersten beiden Argumente zeigen, dass Berufsbildung im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht nicht eine nachgeordnete Rolle für Mobilität spielt, sondern im Gegenteil zentrale Voraussetzungen dafür schafft. Hinzu kommt jedoch ein drittes Argument: Ökonomische Mobilität ist auch ohne tertiäre Bildung möglich, und nicht jede höhere Bildung führt automatisch zu höheren Einkommen.
In besonderem Masse gilt dies, wenn Berufsbildung den Weg in eine erfolgreiche Selbständigkeit eröffnet. Dabei geht es nicht um Scheinselbständigkeit im Rahmen von Ein-Personen-Betrieben, sondern um die Chance, Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln oder zu übernehmen. Die demografische Entwicklung verstärkt diese Möglichkeit: Durch die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation suchen schätzungsweise jährlich rund 15 000 Unternehmen in der Schweiz eine Nachfolgelösung. Viele dieser Betriebe sind im handwerklichen oder dienstleistungsorientierten Bereich tätig, wo akademische Qualifikationen traditionell wenig verbreitet sind.
Damit eröffnen sich für junge Berufsleute aussergewöhnliche Chancen. Wer eine Lehre absolviert und diese mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung ergänzt, kann bereits in jungem Alter in die Rolle als Eigentümerin oder Eigentümer hineinwachsen. Im Erfolgsfall sind die ökonomischen Erträge dieser beruflichen Selbständigkeit oft höher als die Einkommen durchschnittlicher Akademikerinnen und Akademiker. Es ist daher durchaus möglich, dass die Berufsbildung in naher Zukunft nicht weniger, sondern sogar mehr soziale Mobilität ermöglicht.
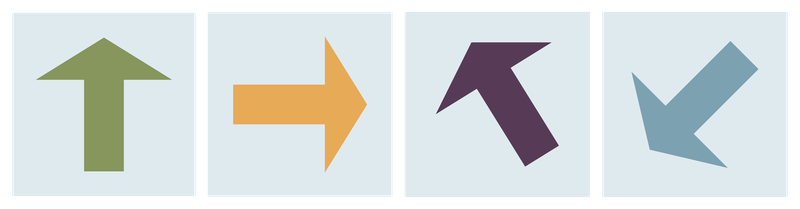
Mobilität nicht «trotz», sondern «dank» beruflicher Bildung
Die Beobachtung, dass die Schweiz sich im internationalen Vergleich durch eine besonders ausgeprägte ökonomische Mobilität auszeichnet, kann im Lichte dieser Überlegungen so interpretiert werden, dass dies nicht «trotz» der starken Verbreitung der dualen Berufsbildung möglich ist, sondern gerade «wegen» der dualen Berufsbildung. Diese erlaubt es nicht nur, unterschiedlichste Talente zur Entfaltung zu bringen, die in klassischen, stark auf Allgemeinbildung fokussierten Bildungssystemen weder gefördert noch berücksichtigt würden. Sie steigert zudem die Lernmotivation bei Jugendlichen, die zwar leistungsbereit und -fähig sind, jedoch stärker durch extrinsische als durch intrinsische Anreize angesprochen werden.
In einem pluralistischen und durchlässigen Bildungssystem wie in der Schweiz bedeutet die Wahl einer beruflichen Ausbildung daher in den meisten Fällen auch keine Abwahl einer höheren und längeren Ausbildung, die für viele gut entlohnte Berufe und Karrieren unabdingbar geworden ist. Angesichts der bevorstehenden demografischen Herausforderungen sowie der technologischen Entwicklungen – Stichwort Künstliche Intelligenz – ist es schliesslich durchaus wahrscheinlich, dass die Bedeutung der Berufsbildung in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, um soziale Mobilität nicht nur zu fördern, sondern vielerorts überhaupt erst zu ermöglichen.
*Die Meinungen von Gastautoren repräsentieren nicht zwingend die Haltung der EDK.
Dieser Beitrag wurde am 8.11.2025 in der NZZ veröffentlicht. Die EDK hat die Bebilderung und grafischen Elemente hinzugefügt. Hier geht’s zum Original.


